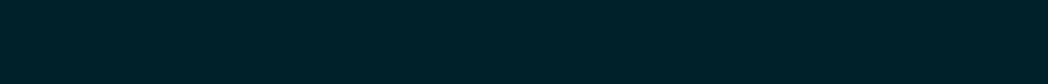Bei so einem Einstieg in die Königsklasse, sagt er, gebe es zwei Möglichkeiten: "Entweder man macht es richtig, oder man macht es gar nicht." Und bei Audi habe man entschieden, es richtig zu machen.
In München lud das Unternehmen unlängst zur großen Auftaktveranstaltung, denn der heiße Start rückt immer näher: Am 8. März 2026 steht Audi erstmals in der Startaufstellung der Formel 1. Es wurde also zurückgeblickt auf die erfolgreiche Geschichte der vier Ringe im Motorsport.
Audis Ziele: "Ambitioniert" und "doch realistisch"
Zylinderförmige Boliden aus den Dreißiger-Jahren, die ikonischen Rallye-Quattros aus den Achtzigern und auch die modernen Prototypen für die Langstrecke dröhnten über den Asphalt. Dies alles sei Ansporn und Verpflichtung für "die ultimative Herausforderung" Formel 1, sagt Döllner: "Wir wollen ab 2030 um die WM kämpfen."
Dieses Ziel sei "ambitioniert" und "doch realistisch" - wie groß der Sprung ist, den Audi da plant, ist eine Autostunde von München entfernt zu erahnen. Nahe dem Unternehmenssitz in Ingolstadt steht das Motorenwerk in Neuburg. Ein Countdown läuft auch hier herunter, Arbeiten unter Hochdruck ist angesagt. "Mehr Zeit kann man immer gebrauchen", sagt Stefan Dreyer, Technik-Chef in Neuburg, bei einer Führung durch das Werk: "Aber es ist auch gut, dass es jetzt bald los geht."
Es ist nämlich so: Audi entwickelt seine Power Unit einigermaßen blind. Denn auf einer Rennstrecke darf der Neuling seinen Antrieb erst im Rahmen der offiziellen Tests Anfang 2026 einsetzen. "Wir haben jede Menge Simulationen, aber wir haben keine Rückmeldung von der Strecke, null", sagt Dreyer: "Das ist ein bisschen angsteinflößend, aber es ist die Herausforderung, die wir wollten."
Zwar müssen auch die anderen Hersteller einen Hybrid-Antrieb für das neue Reglement bauen. Der Elektro-Anteil an der Leistung steigt auf beinahe 50 Prozent - der Verbrennungsmotor allerdings bleibt in weiten Teilen identisch, Mercedes, Ferrari und Co. kennen ihr Aggregat daher viel besser. Wo Audi steht, ist ungewiss. "Wir haben keine Korrelation, das ist unsere größte Aufgabe für das erste Jahr", sagt Dreyer, "und dann brauchen wir eine steile Lernkurve."
Formel 1: Hülkenberg und Bortoleto starten für Audi
Der Ton ist also durchaus unterschiedlich auf der Bühne in München und im Motorenwerk in Neuburg. Deutlich wird allerdings jeweils, dass Audi es ernst meint. 2024 bewertete die Unternehmensspitze das komplette Projekt neu und vollzog den großen Umbruch. Der einstige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und der langjährige Red-Bull-Mann Jonathan Wheatley heuerten an. Zudem beschleunigte Audi die Übernahme des Schweizer Sauber-Teams und besorgte sich durch eine Minderheitsbeteiligung des Staatsfonds von Katar externes Geld.
"Wir haben damals analysiert, dass wir ein ambitionierteres Setup benötigen", sagt Döllner. Auch der Standort im Schweizer Hinwil, wo das Auto entsteht, wurde und wird weiterhin ausgebaut. Aus 500 Mitarbeitenden wurden dort bis heute 700, Tendenz steigend. Um die Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto herum wächst ein Privatteam zum riesigen Werksrennstall heran.
Audi macht das alles, weil die Formel 1 mittlerweile die Chance bietet, weltweit junge Zielgruppen zu erreichen. In schwierigen Zeiten für die Auto-Industrie soll diese Bühne helfen, auf dem Serienmarkt zu bestehen. Und wenn der sportliche Erfolg am Ende doch ausbleibt? Solche Sorgen, sagt Döllner, umtreiben ihn nicht. "Meine größte ist, dass mir der Terminkalender nicht erlaubt, am 8. März in Australien zu sein."