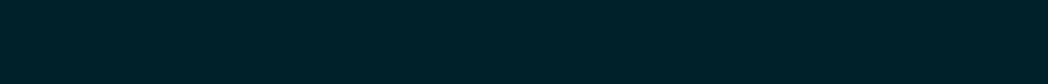In diesem Sommer wurden in der englischen Liga Rekord-Ausgaben in Höhe von bis zu 6 Milliarden Pfund (rund 6,8 Milliarden Euro) für Transfers getätigt. Das ist fünfmal so viel wie vor zehn Jahren in der Saison 2014/15, als die Ausgaben bei 1,4 Milliarden Pfund (rund 1,61 Milliarden Euro) lagen. Gleichzeitig sind die Einkommen in Großbritannien nur um circa 7 Prozent gestiegen, für viele sogar gar nicht. Sind diese Rekordausgaben im Volkssport Nummer 1 wirklich nachhaltig?
Der Transferboom in England bedeutet auch eine Rekordsaison für die deutsche Liga. In keiner Saison bisher ist so viel Geld aus England in die deutsche Liga geflossen. Die Kluft zwischen den beiden Ligen wird dagegen immer größer. Wie wird sich der Ausverkauf der Bundesliga in diesem Sommer auf die Leistungen der deutschen Vereine in Europa und der deutschen Nationalmannschaft auswirken?
Ausverkuf Bundesliga: Auswirkungen auf UEFA-Koeffizient?
In diesem Sommer gab es vor allem mit Florian Wirtz (für bis zu 150 Millionen Euro von Leverkusen zum FC Liverpool), Hugo Ekitiké (für bis zu 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool) und Nick Woltemade (für bis zu 90 Millionen Euro von Stuttgart zu Newcastle Untied) eine Rekordzahl an gwaltiger Transfers zwischen der Bundesliga und der Premier League. Das mag für die deutschen Vereine in Bezug auf die Einnahmen eine gute Nachricht sein. Doch der Wettbewerbsnachteil sollte vor allem mit Blick auf die kommende Europapokalsaison Anlass zur Sorge sein.
Tore, Vorlagen & mehr: Folge Florian Wirtz mit Flashscore
In der Saison 25/26 führte die UEFA-Koeffizientenberechnung, die auf den Ergebnissen der nationalen Vereine in allen Wettbewerben basiert, aufgrund der relativ schwachen Ergebnisse der Bundesligisten im Europapokal in den letzten fünf Jahren dazu, dass Deutschland hinter Italien, Spanien und England auf Platz 4 der Tabelle abrutschte. Das bedeutet, dass nur sechs Bundesliga-Teams, im Gegensatz zu acht Mannschaften in der Saison 2024/25, in Europa vertreten sind, während es aus England derzeit acht sind.
Deutsches Teams mit nur zwei Titeln in der jüngeren Vergangenheit
In der abgelaufenen Spielzeit schaffte es kein Bundesligist unter die letzten Vier in einem europäischen Wettbewerb. Ist der jährliche "Brain Drain“ einer der Gründe für diese Entwicklung?
Historisch gesehen haben englische Vereine 31 Titel in europäischen Wettbewerben gewonnen, deutsche Vereine hingegen nur 22. In der jüngeren Geschichte ist das Ungleichgewicht jedoch noch ausgeprägter. In den letzten zehn Jahren haben nur Bayern München (Champions League 2020) und Eintracht Frankfurt (Europa League 2022) einen europäischen Titel gewonnen, während die Vereine der Premier League immerhin sieben Titel holten, auch wenn es sich zumeist um die Europa League oder die Conference League handelte.
Die Anerkennung des Wertes des 50+1-Modells
Das 50+1-Modell, das im deutschen Profifußball dem Stammverein mehr als die Hälfte der Stimmanteile, also 50 Prozent plus eine Stimme, an seiner ausgegliederten Kapitalgesellschaft und damit auch den Vereinsmitglieder ein wesentliches Mitspracherecht zusichert, sind für die Fans der Bundesliga fast schon heilig. Aber drohen die deutschen Vereine dadurch, den Kampf um europäischen Titel regelmäßigh zu verlieren?
Zum einen wird das 50+1-Modell nicht verschwinden, die Mitgliederzahl in den deutschen Vereinen steigt weiterhin stark an und hat in diesem Sommer einen Rekordwert erreicht. Sieben der zehn Sportvereine mit den weltweit meisten Mitgliedern kommen aus Deutschland. Der FC Bayern hat die 400.000er-Marke geknackt, Borussia Dortmund freut sich über 248.000 Mitglieder, selbst der Zweitligist Hertha Berlin verzeichnet 58.000 Mitglieder, Kaiserslautern über 37.000 und die Drittligisten Hansa Rostock und Arminia Bielefeld jeweils 28.000. Englische Fans können darüber nur staunen und blicken oft neidisch auf den Einfluss, den die deutschen Fans aud Ihre Vereine haben.
Immer höhere Ablösesummen auf der einen Seite – und der Wunsch nach einer glaubwürdigen Mitgliederkultur auf der anderen Seite: wie funktioniert das zusammen? Kann es überhaupt funktionieren? Das deutsche System gerät zunehmend unter Druck, die aktuelle Saison wird zum Härtetest.
Massig deutsch-englische Duelle in der Champions League
Nach dem gelungenen 3:1-Sieg der Bayern zum Champions-League-Auftakt gegen Chelsea nimmt das Spielbetrieb in den europäischen Wettbewerben in der kommenden Woche wieder anlauf. In der Gruppenphase der Königsklasse trifft der aktuelle Meister zudem noch auf Arsenal, Borussia Dortmund, die Tottenham Hotspurs und Manchester City.
Bayer Leverkusen bekommt es ebenfalls mit Pep Guardiolas Elf und Newcastle United zu tun. Eintracht Frankfurt spielt gegen Liverpool und muss auswärts bei Tottenham antreten. In der Europa League und der Conference League gibt es dagegen keine deutsch-englischen Aufeinandertreffen.
England, der Geldkönig – was droht Deutschland?
Die englische Spitzenliga ist zweifellos der Geldkönig im weltweiten Fußball. Der Medienvertrag, der 2023 mit TNT und Sky TV unterzeichnet wurde, garantiert über vier Spielzeiten eine geradezu unfassbare Summe von 7,2 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu zahlen Sky und DAZN im Rahmen des aktuellen Übertragungsvertrags der Bundesliga insgesamt 4,4 Milliarden Euro im selben Zeitraum.
Das Ergebnis ist, dass Saison für Saison viele der besten Spieler aus der Bundesliga nach England wechseln. Dieser Trend hat dazu geführt, dass Fans und Beobachter des deutschen Fußballs den langfristigen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesligavereine befürchten. Einige halten das Ende der 50+1-Regel für unvermeidlich. Ist diese Einschätzung richtig?
Rekord-Investitionen von Unternehmen in die englische Spitzenliga, aber auch Rekordpreise für Eintrittskarten – wie sieht der Vergleich zur Bundesliga aus? Warum ziehen englische Vereine immer mehr Investitionen an? Die oberste Spielklasse in England ist eine der lukrativsten Geldquellen im globalen Sport. Investitionen in die Liga sind auch aufgrund der äußerst liberalen Gesetzgebung in England reizvoll, und dann wohl auch aufgrund der weitreichenden historischen Bedeutung der Kultur des Vereinigten Königreichs. Die die englischen Spitzenvereine gehören zu den bekanntesten im globalen Fußball.
Investoren: In Deutschland die Ausnahme
Elf der zwanzig Vereine der Premier League befinden sich mittlerweile im Besitz von Investoren aus den USA, darunter einige der erfolgreichsten Vereine wie Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Manchester United und West Ham. Auch Leeds United oder Manchester City haben erhebliche Investitionen aus Übersee erhalten.
In der Bundesliga ist der Einfluss ausländischer Investoren durch die der 50+1-Regelung begrenzt. Sie stellt sicher, dass alle Vereine eben zu 51 Prozent im Besitz der Vereinsmitglieder sind, mit Ausnahme von RB Leipzig, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen, die mehrheitlich in Hand von Großkonzernen aus dem Inland sind.
Weitere Ausnahmen sind David Blitzer, der einen Anteil von 45 Prozent beim FC Augsburg ewarb, die Pacific Media Group, die einen Anteil von 10 Prozent beim 1. FC Kaiserslautern hält, und Calvin Ford mit 15 Prozent Anteil am SSV Ulm.
Investitionen bedeuten auch Innovation und Know-how aus dem US-Sport
Obwohl es eine Marketing-Partnerschaft zwischen der NFL und der Bundesliga, die 2022 unterzeichnet wurde, gibt, ist diese hauptsächlich auf Medienproduktion und digitale Innovation konzentriert. Es finden seit einiger Jahre auch NFL-Spiele in Deutschland statt, doch den deutschen Vereinen fehlt weiterhin maßgeblich an Marketing-Know-how aus dem Zukunftsorientierten und extrem profitablen US-Sport.
In Sachen Marketing-Innovation sind US-Sportarten führend, wie Forbes berichtet: Die Top 10 der wertvollsten Sport-Franchises haben ihren Sitz in den USA, lediglich Real Madrid kommt mit einem Wert von 6 Milliarden Euro ansatzweise mit den Werten eines NFL-Teams wie den Dallas Cowboys mit 11 Milliarden Dollar (rund 9,3 Milliarden Euro) mithalten. Jeder, der schon einmal ein Spitzenspiel in einer US-Sportart besucht hat, sei es in der NBA, NFL oder MLB, weiß, wie gut die Vereine vermarktet werden. Das reicht bishin zum Angebot an Fanartikeln oder einer schier unbegrenzten Auswahl an Gastronomie.
Nach jahrelangen Investitionen beginnen nun vor allem englische Vereine, darunter Tottenham Hotspur mit ihrem neuen Weltklasse-Stadion im Norden Londons, nicht nur im Bereich Catering aufzuholen. Die daraus resultierenden Einnahmen sind beeindruckend: Die Einnahmen des Vereins lagen in den letzten 5 Jahren konstant über 500 Millionen Pfund (rund 573 Millionen Euro).
Deutsche Vereine sind liquide und sogar profitabel – ein Vorbild für die Fußballbranche?
Die englischen Vereine sind im Gegensatz zu den Bundesligavereinen, die teilweise aufgrund der strengen Lizenzanforderungen des Dachverbands DFL fast ausschließlich Gewinne erzielen, hoch verschuldet. So waren die Vereine der Premier League zum Stand der Saison 2024 mit insgesamt 9,2 Milliarden Pfund (rund 10,5 Milliarden Euro) verschuldet - bestehend aus Finanzschulden, Transferverbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten.
Im Gegensatz dazu beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten der deutschen Spitzenklubs in der Bundesliga im Jahr 2023/24 auf nur 2,236 Milliarden Euro. Auch in Bezug auf die Erzielung von Einnahmen war die Situation in den deutschen Spitzenlagen noch nie besser. Die Bundesliga und 2. Bundesliga erzielten einen Rekordumsatz von 5,87 Milliarden Euro – ein Plus von 12 Prozent gegenüber den 5,24 Milliarden Euro in der vergangenen Saison – und trugen gleichzeitig über 1,66 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben zu den öffentlichen Finanzen bei.
Die führenden Stars des globalen Fußballs sind für die Bundesliga meist unerreichbar
Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München zur Saison 2023/24 ist mit einem Liga- und Vereinsrekord von 120 Millionen Euro eine herausragende Ausnahme in den letzten 5 Jahren. Die Bundesliga ist aus anderen Gründen beliebt, beispielsweise wegen der Authentizität des Fan-Erlebnisses und der stärkeren Anbindung sowie natürlich wegen der Ticketpreise. Die finanzielle Kluft zur Premier League wird dagegen immer größer. Das stimmt nachdenklich.
Wenn es um Talentsuche und Förderung geht, gehört die deutsche Liga zu den besten, was zum Teil die Nachfrage aus England erklärt. Aber wie weit können die Bundesligavereine kommen, wenn sie weiterhin regelmäßig ihre besten Spieler verlieren?
Zu Beginn der Saison 2025/26 spielen 15 Spieler, die für die DFB-Nationalmannschaft spielberechtigt sind, in der englischen Topliga. Insgesamt 20 Spieler sind in diesem Sommer von Bundesligavereinen zu englischen Klubs gewechselt, 12 in die andere Richtung.
Beispiel Woltemade: Tranfer-Wahnsinn auf der Insel
Ein Blick auf die Namen der Spieler offenbart ein 'Who's Who' der besten und vielversprechendsten Talente der Bundesliga. Nicht zuletzt der Kauf des Stuttgarter Stürmers Nick Woltemade durch Newcastle United für 90 Millionen Euro zum Ende des Transferfesnters. Dieser Transfer kam hinsichtlich der Ablösesumme völlig überraschend und übertraf medial sogar den 150-Millionen-Euro-Transfer von Florian Wirtz zum FC Liverpool im Juni.
Der Unterschied besteht vor allem darin, dass Wirtz mit nur 22 Jahren bereits 33 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft des DFB bestritten hat, Deutschland in allen Altersklassen seit der U-15 vertreten hat und weithin als Weltklasse-Spielmacher gilt. Eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro für einen Stürmer, der in der Saison 2022/23 noch in der 3. Liga spielte, seitdem nur eine wirklich gute Saison in der Bundesliga ablieferte und erst im Juni sein Debüt für das DFB-Team gab, zeigt, wie unausgewogen hoch die in diesem Sommer gezahlten Ablösesummen waren.
Das Angebot aus dem St. James Park zeigt eben jene Kluft nochmals in aller Deutlichkeit auf. Die gesamten Transferausgaben der deutschen Spitzenliga belaufen sich auf weniger als 800 Millionen Euro. Die der englischen Spitzenliga liegen bei 3,1 Milliarden Euro. Der Unterschied besteht zudem darin, dass die Ausgaben der englischen Liga ein Defizit von 1,4 Milliarden Euro ausweisen, während die 18 deutschen Vereine zusammen einen Gewinn von 267 Millionen Euro erzielen.
Das Einnahmen scheinen für die abgebende Vereine zunächst wie ein Segen. Aber wenn es dazu kommt, die Spieler zu ersetzen, müssen deutsche Vereine Abstriche machen, oder ihrerseits unverhältnismäßige Preise zahlen. Die Marktwerte der englischen Teams explodieren dagegen und sind fast dreimal so hoch wie der der deutschen Klubs.
Welche langfristigen Auswirkungen drohen?
Bayer Leverkusen hat den Großteil seiner Meistermannschaft von 2024 verloren: sechs Spieler an englische Vereine, darunter Jeremie Frimpong an Liverpool, Claudio Echeverri an Manchester City und Granit Xhaka an Sunderland. Führende Spieler, die aus der Bundesliga gewechselt sind und ersetzt werden müssen, sind nicht nur Spitzenspieler wie Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt zu Liverpool) und Benjamin Sesko (RB Leipzig zu Manchester United) oder Xavi Simons (RB Leipzig zu Tottenham Hotspurs). Auch Talente wie Jamie Gittens, Mathys Tel, Enzo Millot, Damion Downs, Leo Scienza und Paul Wanner, der beim PSV Eindhoven unterschrieben hat, bevorzugten den Schritt ins Ausland.
Die Auswirkungen auf die Nationalmannschaft sprechen für sich: Der viermalige Weltmeister kam seit dem Gewinn der WM 2014 nicht mehr über das Viertelfinale eines großen Turniers hinaus, die größte Zeit davon befand man sich in einer tiefen Krise.
Eine Wiederholung der schwachen Leistungen der deutschen Vertreter in Europa in der Saison 2025/26 würde den Druck auf die Bundesligavereine, die 50+1-Regel zu überdenken, weiter erhöhen. Sollten sie dazu führen, dass die Bundesliga zu einer Art Entwicklungs-Liga für die Premier League und andere Top-Ligen wird, könnte das Argument für Mitglieder geführte Vereine immer schwächer werden.
Zwang zur Kommerzialisierung?
Ein Besuch beim Spiel von Union Berlin im Westfalenstadion am vergangenen Sonntag war aufschlussreich: Die Fans sind die Stars, inmitten einer wahren Flut von Werbebotschaften. Zumindest was Sponsoring und kommerzielle Deals angeht, scheint es unvermeidlich, dass der deutsche Fußball dem Beispiel der englischen Liga folgen wird. Die zusätzlichen Einnahmen könnten zumindest bedeuten, dass führende Spieler in Zukunft länger in der deutschen Liga gehalten werden könnten.
Aber zu welchen Kosten? Die 50+1-Regel garantiert die Interessen der Fans, die eine Abschaffung, so hat die Vergangenheit beweisen, sicherlich nicht kampflos hinnimmt. Die Spielzeit 2025/26 und das Abschneiden der deutschen Teams in den europäischen Wettbewerben könnte zukunftsweisend sein.